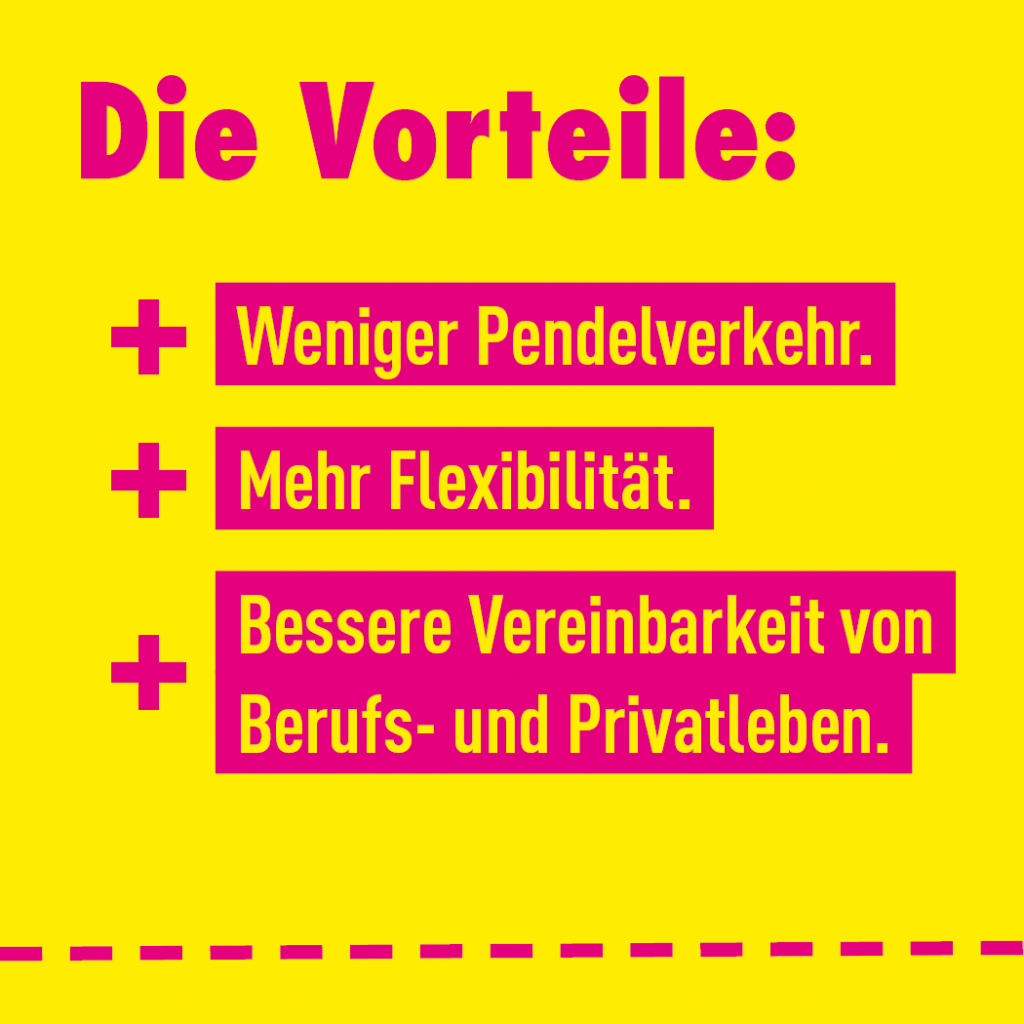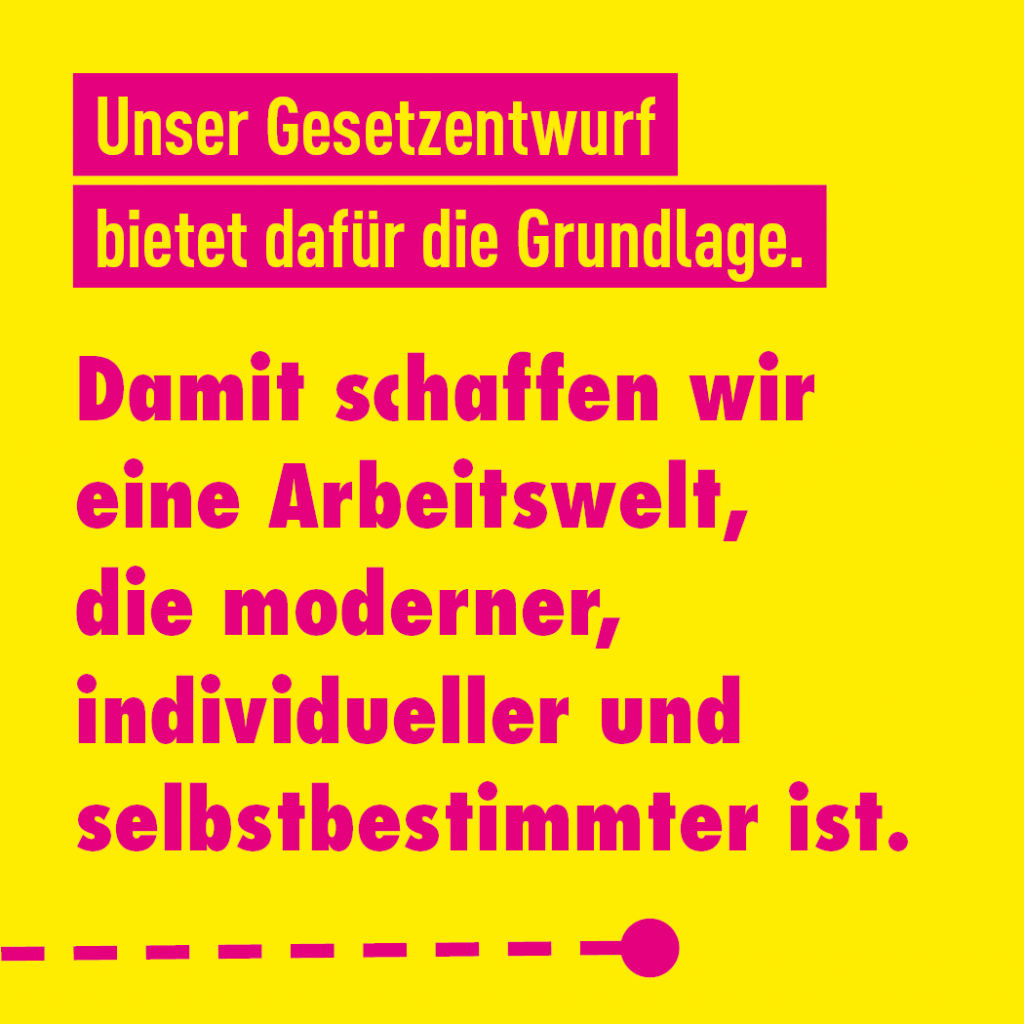Plötzlich ist alles anders

Von den jüngsten Ereignissen im Osten Europas überschattet, nahm die Sitzungswoche des Hessischen Landtags einen anderen Verlauf als geplant. Während am Dienstag und Mittwoch noch die vorgesehene Tagesordnung abgearbeitet wurde, stand der Donnerstag ganz im Zeichen des russischen Angriffs auf die Ukraine. Nachdem die Abgeordneten am Vormittag ihre Solidarität zu den Menschen in der Ukraine bekundeten, empfingen sie am Mittag den ukrainischen Generalkonsul Vadym Kostiuk, der in seiner Rede die europäischen Staaten um Hilfe bat: hinsichtlich Sanktionen gegen Russland, hinsichtlich einer vollständigen Isolation Russlands, durch Waffenlieferungen sowie durch finanzielle und humanitäre Unterstützung.
Solidarität mit der Ukraine
„Der Krieg, die Geißel der Menschheit, ist zurück in Europa“, stellte René Rock nach einleitenden Worten des Ministerpräsidenten Volker Bouffier zum russischen Angriff auf die Ukraine fest. Im Namen der Fraktion der Freien Demokraten sicherte er den Menschen in der Ukraine Solidarität zu. „Wir sind jetzt in Gedanken bei den mehr als 40 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainern, bei den Familien und Kindern, die jetzt um ihr Leben fürchten.“
Es sei ein Krieg, der vor allem die Ukraine, aber letztlich alle Menschen in Europa bedrohe, sagte Rock. Der russische Präsident Wladimir Putin habe gegen die Charta der Vereinten Nationen, das Selbstbestimmungsrecht der Völker und die europäische Friedensordnung verstoßen. „Heute ist ein schlimmer Tag für Hessen, Deutschland und Europa. Die Grenzen von Diplomatie und Vernunft wurden uns heute aufgezeigt.“ Der Fraktionsvorsitzende äußerte sich skeptisch, ob Sanktionen ihr Ziel erreichen würden und forderte, dass der Westen nun zusammenstehen und „mit aller Härte“ gegen Russland vorgehen müsse. Auch vor dem Hintergrund der Erfahrungen des Kalten Krieges, als Hessen an der Grenze des Eisernen Vorhangs lag, bezeichnete Rock die NATO „unsere Lebensversicherung“.
Schrittweise Lockerungen der Corona-Einschränkungen
Während seit diesem Dienstag die erste Stufe der von der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossenen Lockerungen der Corona-Einschränkungen auch in Hessen gilt, nutzte der hessische Ministerpräsident seine Regierungserklärung vor allem dazu, die Bundesregierung für das Auslaufen des Infektionsschutzgesetzes zu kritisieren. „Freiheitseinschränkungen dürfen nicht auf Verdacht oder Vorrat angeordnet werden“, entgegnete ihm der Fraktionsvorsitzende der Freien Demokraten. In seiner Rede verwies René Rock auf sinkende Infektionszahlen sowie die nicht gegebene Überlastung des Gesundheitssystems, die auch der Ministerpräsident eingeräumt hatte. Der Fraktionsvorsitzende forderte eine auf drei Säulen basierende Corona-Politik, bestehend aus einer Wiederherstellung der Grund- und Freiheitsrechte, einem wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Neustart sowie einer Stärkung der Krankenhäuser und des Gesundheitswesens.

Rock machte deutlich, dass auch wenn, wie von der Bundesregierung beabsichtigt, ab dem 20. März nur noch Basisschutzmaßnahmen gelten sollen, Wirtschaft und Gesellschaft nach mehr als zwei Jahren Pandemie noch immer weiter stark belastet seien. Zum Beispiel im Messebereich, in der Büro- und Immobilienwirtschaft, im Hotelgewerbe sowie in der Event- und Unterhaltungsbranche seien Strukturbrüche zu beobachten. „Wir brauchen jetzt einen wirtschaftlichen Aufbauplan“, plädierte Rock. „Nichts tun und auf den Herbst warten reicht nicht.“ Schließlich hätte auch der Expertenrat der Bundesregierung eine Vorbereitung auf eine mögliche weitere Corona-Welle im Herbst sowie ein Vorantreiben der Impfkampagne als zentral bezeichnet. „Das bedeutet unter anderem, kreativer zum Impfen zu motivieren“, appellierte Rock an die Landesregierung. Damit der Gesundheitssektor im Herbst besser vorbereitet und aufgestellt sei als zuletzt, sollten außer der Impf- auch die Teststrategie auch die Beschaffungsstrategie für Impfstoffe, neue Medikamente und Material verbessert sowie die Digitalisierung der Gesundheitsämter und Erkenntnisgewinne durch Monitoring vorangetrieben werden.
- Rede von René Rock im Video (externer Link)
- Dringlicher Antrag Fraktion der Freien Demokraten Niedrigschwellige Impfangebote fördern – Drucksache 20/7941
Mobiles Arbeiten im Landesdienst
Nachdem die Freien Demokraten bereits im vergangenen Herbst einen Vorstoß im Landtag für die Einführung eines Rechtanspruchs auf mobiles Arbeiten für Landesbedienstete unternommen hatten, stand ihre Initiative an diesem Mittwoch zur Abstimmung. Das Ansinnen der Fraktion, die selbst seit Anfang 2019 vorrangig mobil arbeitet, war es unter anderen auch, den öffentlichen Dienst als Arbeitgeber attraktiver und wettbewerbsfähig im Vergleich mit privaten Arbeitgebern zu machen. „Mobiles Arbeiten schafft deutlich höhere Arbeitszufriedenheit und mehr Motivation. Es ist die Zukunft der Arbeitswelt“, erläuterte Stefan Müller den Gesetzentwurf und den begleitenden Antrag. Demnach sollen sowohl Beamtinnen und Beamte als auch Tarifbeschäftigte des Landes einen Anspruch auf 40 Prozent, also zwei Tage pro Woche, mobiles Arbeiten haben, soweit dies mit ihrer Tätigkeit vereinbar ist. „Die Landesverwaltung kann einen entscheidenden Entwicklungsschritt machen und eine Vorbildfunktion einnehmen, wenn sie dauerhaft ermöglicht, was während der Corona-Krise schon funktioniert hat.“
Auch bei der Anhörung, die im Januar stattgefunden hatte, war die Initiative der Freidemokraten auf große Zustimmung gestoßen. Die Mehrheit der Experten hatte befürwortet, dass neue Arbeitsformen in der Realität abgebildet werden sollten und darüber hinaus bestätigt, dass die Arbeits- und Rahmenbedingungen vor allem für junge Menschen wichtig seien und dazu auch das ortungebundene Arbeiten gehöre. „Entscheidend ist doch das Arbeitsergebnis und nicht, wo der Laptop aufgeklappt oder der PC hochgefahren wird“, konstatierte Müller in der Landtagsdebatte. Er stelle die vor allem im Landesdienst etablierte Präsenzkultur in Frage. „Es ist klar, dass der Pförtner im Ministerium seinen Job in Präsenz erledigen muss. Aber es spricht nichts dagegen, dass die Sachbearbeiterin ihren Job von zu Hause aus oder an einem ganz anderen Ort erledigt. Nur weil einige ihre Aufgaben nicht mobil erledigen können, darf die Möglichkeit nicht auch allen anderen vorenthalten werden.“ Anregungen aus der Anhörung in Bezug auf die auch beim mobilen Arbeiten einzuhaltenden Arbeitszeiten hatten die Freien Demokraten im Rahmen eines Änderungsantrags aufgegriffen. „Wir wissen, dass die Einhaltung der Arbeitszeit eine besondere Herausforderung darstellt. Daher haben wir in den Gesetzentwurf ausdrücklich den Hinweis aufgenommen, dass der Umfang der Arbeitsstunden auch im Homeoffice beziehungsweise beim mobilen Arbeiten einzuhalten ist“, erklärte Müller abschließend. Trotzdem fand der Gesetzentwurf im Landtag keine Mehrheit und wurde mit den Stimmen von CDU und Grünen abgelehnt.
- Mehr zum Thema: „Moderne Arbeit ist mobil“
- Gesetzentwurf Fraktion der Freien Demokraten Recht auf mobiles Arbeiten für Landesbeamte – Flexibilität und Attraktivität des öffentlichen Dienstes stärken – Drucksache 20/6387
- Antrag Fraktion der Freien Demokraten Recht auf mobiles Arbeiten für Tarifbeschäftigte – Flexibilität und Attraktivität des öffentlichen Dienstes stärken – Drucksache 20/6388
- Änderungsantrag Fraktion der Freien Demokraten zu Gesetzentwurf Fraktion der Freien Demokraten Gesetz über das Recht auf mobiles Arbeiten für Landesbeamte – Flexibilität und Attraktivität des öffentlichen Dienstes stärken – Drucksache 20/7972
Hessisches Bestandsmanagement für den Wolf

In Hessen gibt es immer mehr Wölfe. Außer mehreren Einzeltieren sind hierzulande ein Wolfspaar sowie ein Rudel mit mehreren Wolfswelpen sesshaft geworden. Nach zahlreichen Rissen bleiben nunmehr auch Begegnungen mit dem Tier nicht mehr aus: Erst Anfang Februar wurde ein Jungwolf in einem Wohngebiet im Vogelsberg gesichtet.
Die stetig wachsende Wolfspopulation in Hessen haben die Freien Demokraten in dieser Plenarwoche zum Thema im Landtag gemacht. „Wir müssen uns mit der Frage beschäftigen, wie viele Wölfe in Hessen akzeptabel sind – und wo“, erklärte Wiebke Knell die Initiative ihrer Fraktion. Darin fordern die Freien Demokraten ein hessisches Bestandsmanagement für den Wolf nach dem Vorbild der skandinavischen Schutzjagd. So gibt es in Skandinavien einerseits Wolfsschutzzonen, zum Beispiel in großen, zusammenhängenden Waldgebieten, aber auch jene Gebiete, in denen der Wolf nicht willkommen ist, die eine Gefahr darstellen und wo deshalb bei einer zu großen Population abgeschossen werden kann. Das können zum Beispiel Ortsrandlagen und Gegenden sein, in denen Weidetiere gehalten werden. „Für das Bestandsmanagement wird eine optimale Bestandsgröße an Wölfen ermittelt. Erst wenn die Populationsgröße über den festgelegten Bestand hinausgeht, kann die Differenz entnommen werden, und zwar nicht wahllos überall, sondern in festgelegten Gebieten“, erläuterte die landwirtschafts- und umweltpolitische Sprecherin. Knell berichtete, dass in den Orten, in denen sich Wölfe angesiedelt haben, die Menschen inzwischen teilweise verängstigt seien. „Manche trauen sich nicht mehr in den Wald, legen bestimmte Strecken nicht mehr zurück oder sorgen sich um ihre Nutz- und Haustiere.“
Ergänzend zum Bestandsmanagement forderte Knell auch eine Populationsstudie. Sie ist überzeugt, dass es für ein Bestandsmanagement auch verlässliche Zahlen brauche, die aktuell nicht vorlägen. „Zumindest gibt es aber zahlreiche Hinweise darauf, dass es mehr Wölfe gibt, als es das Monitoring des Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie vermuten lässt.“ Knell verwies ergänzend auf Berechnungen, die pro Jahr von einem über 30-prozentigen Wachstum der Wolfspopulation in Deutschland ausgehen. „Wenn sich dieses rasante Wachstum fortsetzt, haben wir im Jahr 2030 34.000 Wölfe und im Jahr 2035 bereits 144.000. Diese Zahlen zeigen ganz deutlich, dass der Wolf in Deutschland nicht im Bestand gefährdet ist.“ Daher müsse sich jedes Bundesland mit der Frage beschäftigen, wie viele Wölfe eigentlich akzeptabel seien. „Es ist klug und vorausschauend, wenn wir uns jetzt vorbereiten und rechtzeitig in ein Bestandsmanagement übergehen, ehe es zu spät ist“, sagte Knell und verwies auf eine angekündigte Initiative der Ampelkoalition im Bund, die die Möglichkeit für ein Bestandsmanagement eröffnen soll. „Das ist der Weg, den man gehen muss, wenn man ein Zusammenleben von Mensch und Wolf organisieren will.“